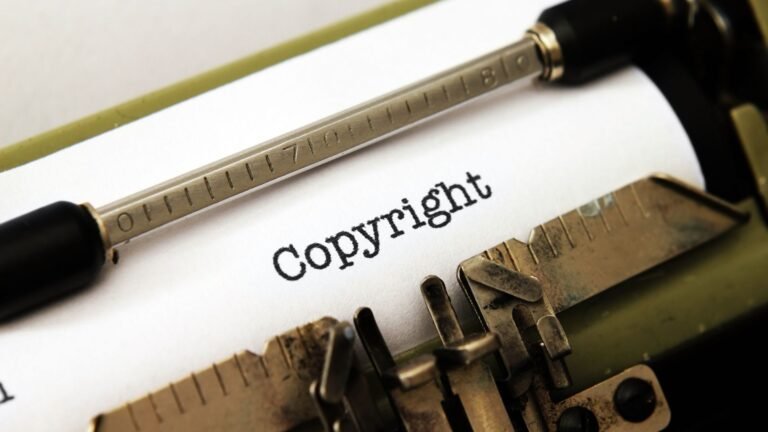Kurz & bündig
Frage: Dürfen KI-Modelle urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Training nutzen – und wie sollen Kreative dafür entlohnt werden?
Antwort: In der EU gibt es seit 2019 Ausnahmen für Text- und Datamining (TDM). Rechteinhaber können aber per Opt-out widersprechen. Mit dem EU AI Act kommen zusätzliche Transparenz- und Copyright-Pflichten für große KI-Modelle (GPAI) hinzu. Befürworter sehen darin fairen Schutz und Vertrauen, Kritiker warnen vor rechtlicher Unsicherheit und Innovationshemmnissen.
Einordnung – warum die Debatte jetzt so intensiv geführt wird
Generative KI kann Texte, Bilder, Musik oder Videos erzeugen. Grundlage sind große Trainingsdatensätze, die häufig aus öffentlich zugänglichen Inhalten bestehen. Urheberinnen und Urheber fragen: „Werden unsere Werke ohne Erlaubnis genutzt?“ Unternehmen fragen: „Wie schaffen wir Rechtssicherheit für Entwicklung und Nutzung?“
Rechtlich greifen mehrere Ebenen: die EU-Urheberrechtsrichtlinie (DSM) mit Ausnahmen für Text- und Datamining (TDM), nationale Ausgestaltung (z. B. in Deutschland) und der neue EU AI Act mit besonderen Vorgaben für General-Purpose-/Foundation-Modelle. Eine Studie des Europäischen Parlaments (2025) betont, dass es weiterhin Reibungen zwischen KI-Training und bestehendem Urheberrecht gibt – etwa bei der Reichweite der TDM-Ausnahmen und bei der Frage, ob KI-Ausgaben selbst geschützt sind.
Hintergrund – TDM-Ausnahmen, Opt-out und neue AI-Act-Pflichten
- Text- und Datamining (TDM): Die DSM-Richtlinie erlaubt TDM für Forschung (Art. 3) und – grundsätzlich – auch für andere Zwecke (Art. 4), sofern kein Widerspruch erklärt wurde. Quelle: Erläuterung zu Art. 4 DSM.
- Opt-out der Rechteinhaber: Wer seine Inhalte nicht für TDM/KI-Training freigeben will, kann das ausdrücklich vorbehalten (z. B. per Maschinenlesbarkeit/robots.txt). Quelle: Überblick zu Opt-out nach Art. 4 (3) DSM.
- Transparenz durch den EU AI Act: Anbieter großer General-Purpose-Modelle müssen u. a. eine „hinreichend detaillierte Zusammenfassung“ der Trainingsdaten veröffentlichen (Vorlage durch das künftige AI Office). Quellen: EU-Kommission, Open Future (2024) zu Art. 53 AI Act, Reuters (2025) – Leitlinien & Fristen.
- Erste Rechtsprechung in Deutschland: Das LG Hamburg befasste sich 2024 mit Datensätzen für KI-Training und urheberrechtlichen Fragen. Quellen: DLA Piper Case Note, IPWatchdog (2024).
Eine Fotografin stellt ihre Bilder auf die eigene Website. Ohne Opt-out könnten die Dateien für Trainingszwecke maschinell ausgelesen werden (TDM). Die Fotografin setzt daher einen maschinell lesbaren Nutzungsvorbehalt (Opt-out). KI-Anbieter müssen diesen Vorbehalt respektieren; andernfalls bräuchten sie eine Lizenz.
Pro – Argumente für stärkeren Schutz & klare Regeln (mit Quellen)
- Leistung der Kreativen honorieren: Verbände wie der Deutsche Kulturrat fordern, dass KI-Training auf geschützten Werken nur mit Lizenz/Vergütung erfolgen soll; Verwertungsgesellschaften (u. a. VG Wort / VG Bild-Kunst, GEMA) entwickeln entsprechende Modelle.
- Transparenz stärkt Fairness: Die Pflicht zu Trainingsdaten-Zusammenfassungen im AI Act soll Rechteinhabern ermöglichen, Nutzungen zu erkennen und Ansprüche geltend zu machen (TechPolicy.Press).
- Missbrauch begrenzen: Ein klarer Opt-out-Mechanismus (Art. 4 DSM) respektiert den Willen der Urheber. So lassen sich massenhafte, unerwünschte Datenabgriffe rechtssicher ausschließen.
- Rechtssicherheit für alle: Wer lizenziert oder Opt-outs beachtet, minimiert Rechtsrisiken und stärkt das Vertrauen in „KI Made in Europe“.
Ein Verlag stellt ein Archiv mit Artikeln bereit. Über einen Opt-out (maschinell lesbar) untersagt der Verlag die Nutzung für KI-Training. Ein KI-Anbieter, der trotzdem trainieren möchte, verhandelt eine Kollektivlizenz mit einer Verwertungsgesellschaft – so werden Autorinnen vergütet und die Nutzung rechtssicher.
Kontra – Einwände aus Tech-Praxis & Forschung (mit Quellen)
- Rechtliche Grauzonen & Fragmentierung: Die EP-Studie (2025) sieht Widersprüche zwischen KI-Training und TDM-Schranken; unklar sei u. a., wie weit Art. 4 DSM reicht und wie Opt-outs praktisch durchgesetzt werden.
- Wirksamkeit von Opt-outs umstritten: Fachkreise weisen darauf hin, dass z. B. robots.txt als Opt-out nicht immer ausreicht oder uneinheitlich interpretiert wird (JURI-Bericht / IFRRO, 2025).
- Transparenzpflichten – aber wie konkret? „Hinreichend detaillierte Zusammenfassungen“ der Trainingsdaten (AI Act, Art. 53) sind noch auszugestalten; zu grobe Listen helfen Rechteinhabern wenig, zu detaillierte gefährden Geschäftsgeheimnisse (Open Future).
- Innovationshemmnis & Standortfrage: Branchenstimmen warnen, strikte Lizenzpflichten vor dem Training könnten Entwicklung in der EU verlangsamen – während global agierende Anbieter in anderen Regionen schneller vorankommen (vgl. Debatte um GPAI-Code of Practice).
Ein Start-up trainiert ein Sprachmodell für medizinische Fachkommunikation. Es soll nur auf lizenzierten und freigegebenen Texten basieren. Die Beschaffung, Dokumentation und Prüfung geeigneter Korpora kostet Monate – während Wettbewerber außerhalb der EU bereits Pilotkunden bedienen. Das Unternehmen fordert klarere Leitfäden und Musterlizenzen.
Was bedeutet das für Kreative, Unternehmen & Öffentlichkeit?
- Kreative & Verlage: Opt-out konsequent setzen; prüfen, ob Kollektivlizenzen (VG Wort / VG Bild-Kunst / GEMA) passende Modelle bieten. Der Kulturrat fordert belastbare Rahmenbedingungen.
- Unternehmen & Entwickler: Frühzeitig Copyright-Risiken adressieren: Herkunft der Daten dokumentieren, Opt-outs respektieren, Trainingszusammenfassungen vorbereiten (EU-Leitlinien 2025).
- Öffentlichkeit: Transparenzpflichten des AI Act sollen helfen zu verstehen, woher Modelle lernen. Das kann Vertrauen stärken – sofern Angaben wirklich brauchbar sind.
Offene Punkte – worauf es in den nächsten Jahren ankommt
- Ausgestaltung der Transparenz: Wie detailliert müssen Trainingszusammenfassungen sein, damit Rechteinhaber Ansprüche prüfen können – ohne Betriebsgeheimnisse offenzulegen?
- Durchsetzung von Opt-outs: Wie werden maschinell lesbare Vorbehalte global wirksam – auch gegenüber außereuropäischen Anbietern?
- Rechtsprechung in DACH/EU: Welche Leitlinien setzen kommende Urteile (z. B. zu TDM-Reichweite, Datensatz-Kopien, Zwischenspeicherung)? Erste Orientierung: LG Hamburg (2024).
- Praxisfähige Lizenzmodelle: Werden kollektive Modelle (VGs) breit akzeptiert? VG Bild-Kunst schildert Hürden – u. a. Territorialität des Urheberrechts gegenüber globalen Anbietern.
Neutraler Blick: Stärkerer Schutz und klare Vergütung können Akzeptanz und Rechtssicherheit erhöhen (Kulturrat, Verwertungsgesellschaften). Gleichzeitig warnen Tech-Akteure vor Überregulierung, unklaren Opt-out-Mechanismen und hohen Kosten, die junge Unternehmen benachteiligen könnten (GPAI-Code-Debatte). Entscheidend wird die praxisnahe Umsetzung: verständliche Opt-outs, handhabbare Transparenzvorgaben und tragfähige Lizenzmodelle – damit Innovation und Urheberrecht gemeinsam funktionieren.